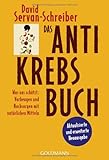„Action,
Leute, ich will Action sehen. Ja, gut, genau! So muss das sein, so wird da ein
Schuh draus!“ Klaus heizte seinem Team ein. „Aber Lisette, Mäuschen, dein
Lächeln ist ja bezaubernd, nur leg bitte etwas mehr Selbstvertrauen hinein! Sei
keck, los, mach Hartwig an, dafür hast Du doch diese Sahneschnitte!“
Statt
zu flirten, prustete Lisette jedoch plötzlich los.
„Was
denn, was denn jetzt? Lisette! Was soll das?“
Während
Klaus noch ratlos um sich sah, drehte Hartwig sein Gesicht in Richtung Kamera, bis
er Klaus im Blick hatte und zeigte ihm frontal seine hochgezogene linke
Augenbraue.
Arne,
der Kameramann, war begeistert: Hartwig in Bestform. Reduzierte, isolierte Mimik
mit maximaler Wirkung. Ein echter Könner.
Klaus
sah das allerdings anders: „Das ist jetzt nicht Dein Ernst! Du verschwendest
meine Zeit. Verflucht, Du bist ein Vollprofi, mach gefälligst keinen Scheiß,
klar? Spiel deine Rolle und spar Dir den Spaßvogel!“
„Aber
natürlich“, stimmte ihm Hartwig, der Vollprofi, seelenruhig zu und drehte
langsam seinen Kopf zurück in Position.
Für
eine Sekunde schien die Situation geklärt und Klaus befriedigt, doch dann
kicherte Lisette erneut.
„LISETTE!“
„‘Tschuldigung“,
gluckste sie und schloss die Augen, um zur Ruhe zu kommen. Sie atmete tief ein,
blickte anscheinend gesammelt zu Hartwig – und fing sofort wieder an.
Klaus
verdrehte die Augen, aber das half ihm auch nichts: schmunzelnd wandte Hartwig sich
zum zweiten Mal in Richtung Kamera und zeigte sein gekonntes
Augenbrauenhochziehen, während Lisette sich mit jeder weiteren seiner Zuckungen
mehr und mehr in einen Lachanfall hineinsteigerte.
Es
dauerte eine geschlagene viertel Stunde, bis sie sich endlich beruhigt hatte
und der Dreh weitergehen konnte. Aber jetzt brachte sie es: das Mädchen
flirtete auf Teufel komm raus mit Hartwig.
Nur
wenig später rief Klaus erleichtert: „Cut!“, und Hartwig verließ zufrieden seinen
Platz, während ein anderer diese Position einnahm. Als er an Arne vorbeikam,
raunte Hartwig selbstzufrieden: „Ich habe ihm nur bei seinem Job geholfen.“
„Und
das hast Du verdammt gut gemacht!“
Die
nächste Szene begann mit einem closeup auf Lisettes Augen, in die sie jetzt
einen sexy Silberblick legte, und für Arne wurde sein Job plötzlich verteufelt
unbequem, als ihr Flirt mit der Kamera viel mehr ihn persönlich zu meinen
schien, es in seiner Hose höllisch eng wurde und er sich kaum an die nächste
Einstellung erinnern konnte. Er musste alle noch brauchbaren Gehirnzellen zusammenkratzen,
um von ihrem Gesicht auf den Picknickkorb zu schwenken, in den ihre zarten Hände
eintauchten und Stück für Stück eine Decke, Teller und Gläser, Besteck und
Flaschenöffner, Wein, Weintrauben und Käse hervorholten. Doch schon als sie das
rot-weiß karierte Tuch sorgsam ausgebreitet hatte, begann Arnes Körper, sich zu
beruhigen.
Während
Lisette alles weitere flink an den für die Kamera unsichtbar markierten Plätzen
positionierte, war es Zeit für ihren Text: „Ich habe ein Gedicht über Blind
Dates geschrieben. Warte, ich lese es Dir vor.“
Gleich
darauf schwamm ihr Blick haltlos durch das Bild, während sie ein Blatt Papier
hervorkramte, es mit tastenden Bewegungen auseinanderfaltete, um es
anschließend mit zusammengekniffenen Augen zu taxieren und ihr Gesicht verriet,
wie wenig sie laut Drehbuch erkennen konnte.
Arne,
nun wieder ganz Herr seiner selbst, konzentrierte sich auf die Nahaufnahme
ihrer Hände, folgte der linken, die ein pinkfarbenes Etui aus dem Korb fischte,
es öffnete, eine Brille herausnahm, das Etui fallen ließ, die Brille auseinanderklappte
und auf ihre Nase setzte, womit die Kamera wieder die Augen erfasste, die sich
scheinbar am Papier auf ihrem Schoß festgefressen hatten. Als Lisette anschließend
zufrieden lächelnd zu dem vor sich sitzenden Mann sah, erstarrten ihre gerade
noch anmutigen Bewegungen.
Die
Kamera folgte ihrem fassungslosen Blick und im Angesicht einer glubschäugigen,
schnapsnasigen Visage mit ekelhaft gelben Stummelzähnen würde später eine
Stimme aus dem Off feststellen: „Mit Supra-Lens wäre ihr das nicht passiert.“